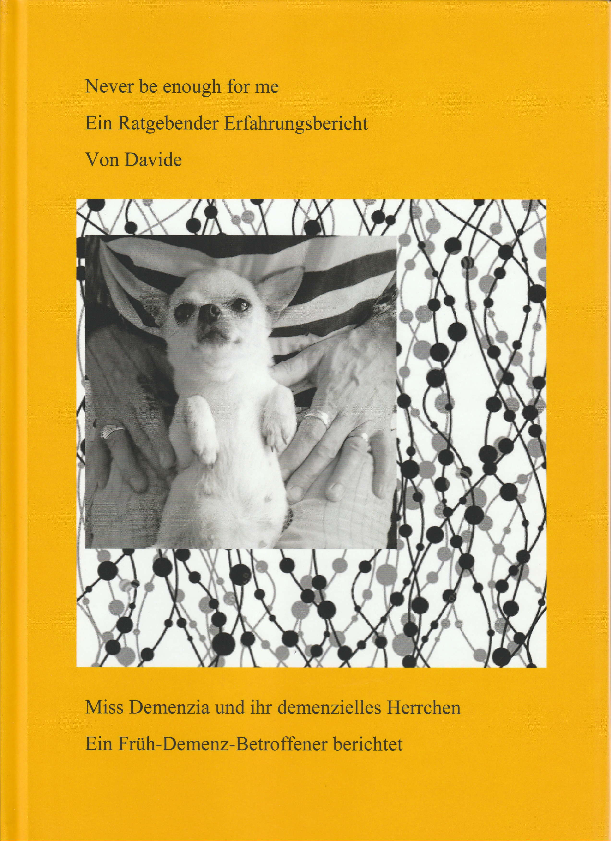Erfahrungen von Menschen mit Demenz
Demenzerkrankungen führen zu unterschiedlichen Veränderungen. Menschen werden nicht nur vergesslich, sie bekommen Probleme mit der Sprache und der Orientierung. Oft verändert sich ihr Verhalten oder ihr ganzes Wesen. Doch Menschen mit Demenz möchten nicht auf diese Diagnose beschränkt werden. Sie verfügen über Fähigkeiten, wollen selbstbestimmt leben, wollen mit einbezogen werden, wollen sich aktiv einbringen.
„Ich fordere Sie auf umzudenken, uns Demenzerkrankte ernst zu nehmen, uns sprechen zu lassen, nicht aus der Gesellschaft auszugrenzen und wie Aussätzige zu behandeln.“ Martina Peters lebte viele Jahre mit der Diagnose Alzheimer. Sie sprach 2006 als erste Betroffene auf einem deutschsprachigen Demenz-Kongress. Auf dieser Seite berichten sie und andere Betroffene was sie sich von ihrem Umfeld und der Gesellschaft wünschen. Und sie erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen.
Wenn auch Sie eine Erfahrung teilen möchten, schreiben Sie gerne eine
E-Mail an Nora Landmann. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Sie müssen nicht Ihren vollständigen Namen angeben und können auch ein Pseudonym verwenden. Ihren Text veröffentlichen wir auf dieser Seite.
Mein Abschied aus dem Arbeitsleben vor sechs Jahren ist mir sehr schwer gefallen. Ich war Banker in leitender Position und mit Personalverantwortung und es ging mir gut mit der Arbeit, ich habe das sehr gerne gemacht. In der ersten Zeit habe ich Anzeichen wie Dinge suchen, Namen vergessen, Probleme mit der Orientierung darauf geschoben, dass ich nicht mehr arbeitete, die Diagnose «Alzheimer» kam dann erst drei Jahre später. Es folgte eine schwere Zeit voller Ungewissheit, Zweifel und Angst, mit der Krankheit klarzukommen und sich auf ein Leben ohne Erinnerung an die Vergangenheit einzustellen. Meine Familie – meine Frau, meine vier Söhne und sieben Enkel – haben mir sehr geholfen, mit der Krankheit klarzukommen. Belastend war für mich allerdings der stille Rückzug vieler «guter Bekannter». Gleichzeitig ist ein Segen, die wahren Freunde nun in großer Verbundenheit zu erleben.
Vor gut zwei Jahren habe ich beschlossen, mich der Krankheit zu stellen. Ich trinke keinen Alkohol mehr, habe das Rauchen aufgegeben und bewege mich sehr viel. Ich verlange von mir selbst, alles alleine zu machen, nutze mein Handy bei der Organisation vieler Themen und lebe dabei im HIER und JETZT. Die Krankheit hat mir viele Erinnerungen genommen und das macht mich immer wieder sehr traurig, aber dafür erlebe ich die Gegenwart jetzt in einer Intensität, wie ich sie in Zeiten von Arbeit und Alltagssorgen nie gekannt habe.
Was ich brauche – ebenso wie alle Menschen mit Demenz – sind «Sparringspartner», Gesprächspartner, die mir offen zuhören und mich nicht in eine Schublade stecken. Ich bin auch der Meinung, wenn über Demenz gesprochen wird, dann sollten das Menschen mit Demenz selbst tun. Viele haben Angst sich zu zeigen, aber wenn sie es tun, wird so viel Potenzial sichtbar! Deshalb bin ich bei der Alzheimer Gesellschaft Hamburg aktiv und im Beirat der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Es geht mir im Wesentlichen darum, Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen, besser mit der Krankheit umzugehen. Als Selbstbetroffener kommen die eigenen Erfahrungen glaubwürdig an und helfen.
Ja, auch ich habe manchmal Angst vor der Zukunft. Aber das ist dann auch wieder eine Motivation zu sagen "jetzt zeig’ ich’s dir!" Wir waren immer und sind auch jetzt auf Augenhöhe. Meine Frau war nie "nur" Hausfrau und Mutter und ich bin durchaus autark, kann kochen, saugen usw. Ich versuche ein Vorbild auch für andere Menschen mit Demenz zu sein, indem ich nicht nur Vorträge halte, sondern es einfach vorlebe, was mit Demenz noch alles möglich ist. Denn: "Demenz ist nichts für Feiglinge – aber noch lange kein Grund aufzugeben!"
Rainer Heydenreich, Mitglied im Beirat „Leben mit Demenz“ seit Ende 2023
Dieser Beitrag erschien im Alzheimer Info 4/2024
Wie viele andere Menschen war auch ich zum Ende der Pandemie 2021 begeistert, wieder in ein Flugzeug steigen zu dürfen. Entfernte Familienmitglieder, Freunde und Bekannte im Ausland endlich wieder in die Arme schließen oder Veranstaltungen der Alzheimer-Gesellschaften im europäischen Ausland besuchen. Bei meinem letzten Flug 2018, vor der Pandemie, konnte ich noch ohne wesentliche Einschränkungen meine Flüge buchen und antreten. Doch im Herbst 2021 musste ich umdenken. Als Mensch mit einer frühen Demenz (Lewy-Body-Demenz) war eine intensive Vorbereitung erforderlich. Im Internet fand ich viele interessante und auch nutzbringende Informationen. Sehr wichtig und hilfreich war die Information für behinderte und mobilitätseingeschränkte Fluggäste. Mit Wirkung vom 26. Juli 2008 gilt diese EU-Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juli 2006
Diese definiert und stärkt die Rechte von behinderten Menschen und Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität (PRM – Persons with Reduced Mobility). Dazu gehören auch Menschen mit Demenz wie ich.
Außerdem müssen die Fluggesellschaften in der Europäischen Union Menschen mit Behinderung kostenlose Hilfe anbieten. Das gilt für alle Bereich am Flughafen sowohl am Abflug-, Ziel- und Zwischenflughafen. Und das gilt auch im Flugzeug. Zum Beispiel muss es Mitarbeiter*innen geben, die beim Ein- und Aussteigen, beim Transport von Gepäck oder beim Gang zur Toilette helfen. Medizinischen Geräte und auch zwei Hilfsmittel müssen die Fluggesellschaften kostenlos mitnehmen, zum Beispiel einen Rollstuhl oder einem Rollator wie in meinem Fall.
So buchte ich meine Flüge mit einem guten und sicheren Gefühl. Leider waren die Theorie und die von mir selbst erlebte Praxis und Realität sehr unterschiedlich. Das bekannte postpandemische [Reise-]Chaos mit Verspätungen, Pannen, verlorenem und beschädigtem Gepäck etc. ist schon schlimm genug für Menschen, die sich schnell anpassen können, aber für einen Menschen mit Demenz wie mich, war es oft eine Katastrophe. In meiner Welt einer Reisenden mit Demenz sehen meine persönlichen Erfahrungen wie folgt aus: Als erstes der Flug nach Portugal im Herbst 2021 mit Zwischenstopp in Frankfurt/Main. Der Flug von Berlin landet mit deutlicher Verspätung in Frankfurt/Main. Der gebuchte Anschlussflug nach Portugal war bereits in der Luft. Für die notwendige Hotelunterbringung für eine Nacht waren keine Service-Leistungen für Menschen mit Behinderung machbar. Auch beim Weiterflug am kommenden Tag waren nur durch die Unterstützung des Reisebüros und meiner Tochter die erforderlichen Serviceleistungen für mich machbar. Zu guter Letzt wurde auf dem Rückflug dann noch mein Rollator zerkratzt und verbeult.
Auf einem Rückflug von Bukarest über Frankfurt/Main nach Berlin im Herbst 2022 hat mich der Rollstuhlservice an einem Gate am Frankfurter Flughafen „vergessen“. Auch hier war telefonische Hilfe und Unterstützung durch mein Reisebüro gefragt. Als ich mich beschwerte, sagte die Verantwortliche vom Service-Team des Flughafen Frankfurt/Main: „Warum fliegen Sie noch in ihrem schlechten Zustand, das ist unverantwortlich“. Ich war schockiert ...
Lesen Sie die gesamte Geschichte von Lieselotte Klotz, Mitglied des Beirats „Leben mit Demenz“ der DAlzG, im Dezember 2022 (Weiter auf Seite 2)
Ich bin 62 Jahre und bin/war Lehrerin an einer Gesamtschule. Die Diagnose Demenz war für mich ein absoluter Schock. Ich war wie eingefroren. Zuerst dachte ich, dass es vielleicht ein Versehen sei und dass es vielleicht „nur“ ein Burnout sei. Doch im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass ich diese Diagnose radikal akzeptieren musste.
Es begann alles mit einer verschleppten fürchterlichen Erschöpfung, die mich dazu zwang meinen Hausarzt aufzusuchen. Ich erzählte ihm von Blackouts, Vergesslichkeit, verzögerter Wortfindung und anderen Problemen. Für den Hausarzt war das in jedem Falle eine ernstzunehmende Sache. So schicke er mich zuerst einmal zu einem Neurologen. Darauf folgte eine Odyssee im Ärztedschungel. Schlussendlich landete ich in der Uniklinik. Nach einem stationären Aufenthalt verließ ich die Klinik. In der Tasche hatte ich nun eine Diagnose: „Demenz vom Alzheimer Typ“. Darüber hinaus stand darin ein Vermerk - „bis auf weiteres keine Arbeitsfähigkeit“.
Mein neues Leben mit Demenz begann erst jetzt wirklich
All dies kostete Kraft und Entschlossenheit, die mir zu Beginn fehlte. Heute nach ca. einem halben Jahr scheint es mir manchmal, dass ich keine Erkrankung hätte, weil es mir gut geht. Dann wiederum gibt es Tage, an denen ich im Selbstmitleid und in destruktiven Gedanken zerfließe. Es ist eine Berg und Talfahrt.
Ich habe Bücher zum Thema gelesen, Filme geschaut, kulturelle Veranstaltungen besucht, den örtlichen Sportverein frequentiert, Yoga und Zen praktiziert, mit meinem Mann kleine Reisen unternommen, bin mit unserem Hund viele Kilometer gelaufen, ich habe einen schwerbehinderten Ausweis erhalten.
Ich habe das Glück, dass ich von meinem Mann und mein Sohn Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Natürlich ist es ein Leben mit Demenz und manchmal ist es auch schwer, immer positiv zu denken. Es gibt für mich tatsächliche einige Dinge, die schwer fallen oder auch nicht mehr möglich sind: Zum Beispiel einen Überweisungsträger ausfüllen, die Einnahme der Demenztabletten nicht zu vergessen, pünktlich und ordentlich gekleidet an einem Ort zu erscheinen, an der Supermarktkasse passend zu bezahlen, Entscheidungen klug zu treffen, Auto zu fahren, Schüler zu unterrichten ...
Gerade in unserer Gesellschaft werden Behinderte oft stigmatisiert. So dass ich ausbalanciere, ob ich die Krankheit verschweige oder offenbare, dass ich ein Mensch mit einer Alzheimer Diagnose bin. Oft zeigt sich aber auch, dass die Offenbarung des Krankheitszustandes positiv kommunikative Türen öffnet. So zum Beispiel beim Zahnarzt, im Sportverein, frühere Kollegen....
Für vieles gibt es außerdem Lösungen, die den Handlungsspielraum erweitern. Zum Beispiel hilft mir mein Mann, indem er mir einfache Zugverbindungen (ohne Umsteige) heraussucht. So kann ich trotz Orientierungsproblemen eigenständig kleinere Wegstrecken meistern.
Demenz bleibt Demenz und die Gedanken an die Zukunft ängstigen. Das Leben dennoch zu genießen und im Hier und Jetzt zu leben, ist eine Option. Eine andere Option gibt es nicht.
Erfahrungsbericht im Januar 2023
Astrid Heller erhielt die Diagnose Alzheimer-Demenz im Alter von 51 Jahren. Die Architektin hatte schon länger den Verdacht, dass etwas nicht stimmte, schob die Veränderungen aber zunächst auf den beruflichen Stress und das steigende Alter. Enge Freunde machten sie dann darauf aufmerksam, dass sie häufiger Termine und andere Dinge vergaß. Astrid Heller lebt jetzt seit mehr als fünf Jahren mit der Diagnose und setzt sich dafür ein, das Bild von Demenzkranken in der Öffentlichkeit zu verändern.
Welche Symptome haben Sie zur Zeit? Wie wirken sich diese auf Ihren Alltag aus?
Astrid Heller: Ich bin nach wie vor im „frühen“ Stadium der Erkrankung und habe vor allem mit dem Kurzzeitgedächtnis Probleme. Ich arbeite als Architektin und Innenarchitektin im Architekturbüro meines Mannes in Bad Kreuznach. Diese Arbeit mache ich seit mehr als 25 Jahren und habe daher eine große Routine, auf die ich zurückgreifen kann. Ich erstelle nach wie vor die meisten Entwürfe (Grundrisse, Ansichten, Raumanordnungen etc.) unseres Büros. Ich mache allerdings keine Bauleitung mehr. Dabei muss man sehr schnelle Entscheidungen treffen und das stresst mich zu sehr. Mein Umfeld weiß über meine Erkrankung Bescheid und unterstützt mich.
Sie setzen sich dafür ein, trotz Erkrankung weiter zu arbeiten. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich möchte nicht auf meine Krankheit reduziert werden. Natürlich brauche ich bei manchen Dingen Unterstützung. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. In der Öffentlichkeit herrscht ein Bild von Alzheimer-Erkrankten vor, die sich eher in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit befinden. Bei Demenz denken wir an Menschen, die teilnahmslos im Heim sitzen und kaum noch Kontakt zu anderen aufnehmen können. Ich habe eine Online-Selbsthilfegruppe für junge Betroffene gegründet und in unseren Gesprächen geht es immer wieder darum, wie man der Erkrankung ein anderes Bild geben kann. Wir „jungen“ Erkrankten im Frühstadium werden mit diesem Bild in Verbindung gebracht und dadurch unterschätzt. Ich kenne mittlerweile viele Betroffene, die nach der Diagnose im mittleren Alter entlassen werden, obwohl das eigentlich nicht nötig wäre.
Was müsste passieren, damit sich diese Situation ändert?
Ich denke, Arbeitgeber, die Menschen mit einer Demenz beschäftigen, sollten finanzielle Hilfen oder Steuererleichterungen erhalten. Mit dieser Idee bin ich vor kurzem an Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags herangetreten und habe sie gebeten, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht wird es dazu ein Pilotprojekt der Landesregierung geben.
Interview für das Alzheimer Info 1/2018
Mein Name ist Martina, bin die jüngste von 6 Geschwistern, 2 Brüder und mit mir 4 Schwestern. Ich bin geschieden und habe 2 Kinder ein Mädchen und einen Jungen im Alter von 18 Jahren. Ich bin heute hier um mir Gehör zu schaffen, in der Hoffnung dass, was ich zu sagen habe, Verständnis und auch Umsetzung findet.
Auch meine Mutter war betroffen. Etwa 1971, wahrscheinlich viel früher, äußerte sich die Krankheit bei ihr mit Dinge verlegen, Personen die sie angeblich gesehen haben will, bis hin zum Verlaufen am Wohnort usw. bis nichts mehr ging und sie an Gehirnschlag gestorben ist.
Etwa 1990 hatte mein Bruder nach heutigem Stand die ersten Symptome, im gleichen Alter wie ich. Er ist jetzt viel allein. Soll jetzt aber in betreutem Wohnen untergebracht werden, laut Anordnung vom Hausarzt, zur eigenen Sicherheit. Bei diesem Gedanken kommen mir schon wieder die Tränen.
Etwa 1992 ist auch meine Schwester erkrankt, die damals unsere Mutter betreute.
Etwa 2003 äußerte sich bei mir die Krankheit durch die typischen Ausfallerscheinungen. Etwa 2004 verlor ich durch die Krankheit meine letzten drei Arbeitsstellen.
Dezember 2005: In der Hoffnung dass, sich mein schrecklichen Ahnen nicht bewahrheitet, habe ich mich selbst testen lassen, durch Entzug von Hirnwasser. Das Ergebnis kam sechs Tage vor Heiligabend. Positiv.
2006: Ich bin nach der Diagnose nur noch mit dem Drahtesel unterwegs gewesen, um meine Wut gegen A. Alzheimer und alles wegzutrampeln. Am meisten leide ich darunter, das sich so genannte Freunde und Bekannte von mir zurückgezogen haben. Somit haben sie unbewusst dafür gesorgt, je nach meiner Tagesform, dass ich nicht mehr zu persönlichen Einladungen gehen möchte.
Unter anderem sind auch Missverständnisse aufgetreten, z.B. war ich bei einer Freundin, die mir 20 € zum Geburtstag geschenkt hat. Einen Tag später wollte ich davon Kuchen kaufen und stellte fest, dass ich die 20 € doch nicht mitgenommen hatte. Ich rief sie an und fragte sie, ob bei ihr das Geld noch liegen würde und sie beharrte darauf, dass sie mir das Geld mitgegeben hätte. Ich fing an ihr zu misstrauen. Und doch konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie mich belügen würde. Ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet, dass ich es doch verloren habe. Aber es war anders. Ich habe es so gut in meinem Portemonnaie klein gefaltet in ein Fach gelegt, wo ich es beim Suchen übersehen habe. Somit bringe ich andere Menschen auch noch in eine missliche Lage. Ich habe ich Sie in eine verzwickte Situation gebracht, indem ich ihr mitteilte, dass sie mir nicht die 20 € gegeben hat.
Wissen Sie wie es ist, wenn man zu keinem Menschen mehr vertrauen hat? Wenn Sie das Gefühl haben, jeder will einem was oder ist nicht ehrlich zu einem? Dieses Misstrauen kann einen madig machen und außerdem die letzten Freundschaften zerstören.
Ich könnte die Liste noch weiter fort führen. Doch ich denke, Sie alle hier kennen, die Symptome. Außerdem fordere ich Sie auf, umzudenken, uns Demenzkranke ernst zu nehmen, uns sprechen zu lassen, nicht aus der Gesellschaft auszugrenzen und wie Aussätzige zu behandeln. Nur weil Worte nicht immer sichtbar sind? Zum Beispiel Alzheimerforen oder Cafes einzurichten, wo sich jung und alt, krank und gesund austauschen kann, so wie das in Holland schon geschehen ist. Nur durch Kommunikation, Aufklärung und Achtung vor dem Menschen, egal ob behindert oder nicht, kann das Ausgrenzen in der Gesellschaft verhindert werden.
Ach übrigens, ich bin nicht doof .... nur vergesslich ....
Martina Peters bei der Eröffnung des internationalen Alzheimer Kongresses, Berlin, 12. Oktober 2006.
Veröffentlicht im Kongressband der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, Berlin, 2007
Gudrun Troitzsch lebt seit 2011 mit der Diagnose „Alzheimer“. Ich habe mit ihr am Rande des Gründungstreffens der „Arbeitsgruppe Sicherheit und Selbständigkeit bei Demenz“ der Nationalen Allianz in Berlin gesprochen.
Gudrun Troitzsch wohnt allein in ihrer Wohnung in München und sagt, dass das für sie die beste Lösung ist: „Ich lebe alleine und muss alles alleine machen. Das fordert mich, und das ist gut so. Ich höre in der Gruppe für Menschen mit beginnender Demenz, die ich besuche, von den anderen, wie viel ihnen von ihren Angehörigen abgenommen wird. Vieles auch, was sie noch alleine machen könnten. Sie sind darüber manchmal frustriert.
Bei mir ist es so, dass manche Dinge sehr lange dauern, vor allem, wenn ich einen schlechten Tag habe. Aber ich bekomme es schließlich hin. Um mein T-Shirt anzuziehen habe ich heute Morgen 20 Minuten gebraucht. Für mich ist das O.K., aber einem Angehörigen kann man so viel Geduld gar nicht abverlangen.“
Gudrun Troitzsch ist 66 Jahre alt und stammt aus Sachsen-Anhalt. Ein Teil ihrer Geschwister lebt noch immer dort, Tochter und Enkelin wohnen in München, doch Kontakt zur Familie besteht kaum. Lediglich die 19-jährige Enkelin schaut einmal im Monat bei ihr vorbei.
Diagnose, aber keine Beratung
Angefangen hat es bei Gudrun Troitzsch mit Halluzinationen: „Ich bin dann nachts im Park umhergeirrt. Dort wurde ich völlig verwirrt und orientierungslos aufgefunden und kam ins Krankenhaus.“
Viele Untersuchungen später erhielt sie vom Arzt die Diagnose, „einfach so: Diagnose – Tür zu. Er hat mir nicht erklärt, was das jetzt für mich bedeutet oder wo ich Hilfe bekomme. Daraufhin bin ich nach Hause gegangen, habe mich eine Woche lang eingeschlossen, habe nichts gegessen, mit niemandem gesprochen.“
Schließlich kam sie auf die Idee, bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um Rat zu fragen. Dort war sie früher selbst ehrenamtlich aktiv. Bei der AWO erhielt sie den Vorschlag, in eine Tagesstätte zu gehen. Dort fühlte sie sich aber nicht am richtigen Ort, weil die anderen Besucher viel älter waren als sie und die angebotenen Aktivitäten für sie nicht passten.
Hilfreicher war der Tipp, sich an die Alzheimer Gesellschaft München zu wenden. Diese hat Angebote für Menschen mit „Demenz mitten im Leben“ (DemiL). Seit 2012 besucht Gudrun Troitzsch die Gruppe DemiL, hat an einer Reise für Menschen mit beginnender Demenz nach Frankreich teilgenommen und bringt sich bei jeder Gelegenheit mit ihren Erfahrungen als Betroffene ein.
Im Alltag helfen feste Routinen
In ihrem Alltag hat sich Gudrun Troitzsch auf das Leben mit der Demenz eingerichtet: „Mein wichtigstes Hilfsmittel ist mein dicker Kalender. Dort notiere ich alle Termine, was wichtig ist und auch, was ich gemacht habe. Leider kann ich später nicht immer alles lesen, was ich eingetragen habe, und muss dann jemanden bitten, es mir vorzulesen.
Weil ich die Uhr nicht mehr lesen kann, habe ich mir eine sprechende Uhr zugelegt, wie Blinde sie benutzen. Ich kann auf einen Knopf drücken, und dann wird mir die Zeit angesagt. Allerdings komme ich nur mit den vollen Stunden richtig klar. Deshalb komme ich zum Gruppentreffen oft eine Stunde zu früh.
Morgens nach dem Aufwachen weiß ich oft nicht, wo ich bin. Dann hilft mir die feste Routine, die ich mir zugelegt habe: Zuerst gehe ich zum Schreibtisch und reiße das Kalenderblatt ab. Danach geht es ins Bad. Alle wichtigen Unterlagen habe ich in einer Mappe auf meinem Schreibtisch greifbar.
Meinen Schlüssel habe ich früher, vor der Demenz, öfter mal vergessen. Ich musste regelmäßig den Schlüsseldienst rufen. Heute passiert mir das nicht mehr, denn ich habe einen ganz festen Platz für den Schlüssel und habe mir feste Abläufe antrainiert, sodass ich den Schlüssel immer einstecke.
Aufs Kochen verzichte ich allerdings völlig, weil die Gefahr zu groß ist, dass ich vergesse, den Herd auszuschalten. Ich habe mir angewöhnt, alles immer wieder zu kontrollieren. Trotzdem ist es mir kürzlich passiert, dass ich die Hose auf links angezogen habe und so auf die Straße gegangen bin.“
Ein offener Umgang mit der Krankheit hilft – außer im Kontakt mit Ärzten
Wenn sie auf der Straße die Orientierung verliert, fragt sie Passanten nach dem richtigen Weg. Manchmal ruft sie auch bei der Alzheimer-Gesellschaft an und lässt sich mit dem Handy nach Hause dirigieren.
Allgemein macht sie gute Erfahrungen damit, offen über ihre Krankheit zu sprechen. Schwierig ist es aber im Umgang mit Ärzten: „Sie hören auf mit mir zu reden, wenn sie vom Alzheimer erfahren. Und weil ich alleine, ohne Angehörige, in der Sprechstunde bin, spricht der Arzt dann mit der Sprechstundenhilfe über mich, aber nicht mit mir. Ich habe keine Chance, Erklärungen zu bekommen, als wäre ich ein Baby. Deshalb versuche ich, möglichst nicht krank zu werden.“
Unterstützung sollte passgenau sein
Unterstützung erhält Gudrun Troitzsch durch einen Pflegedienst, der ihr morgens die Tabletten bringt. Zeit für ein Gespräch haben die Pflegekräfte leider nie. Eine Zeitlang kam auch eine Dame vom ehrenamtlichen Besuchsdienst, doch „sie war zwar sehr bemüht, für mein Temperament aber viel zu langsam und hat auch immer versucht, mir alles abzunehmen und mich zu bemuddeln. Das mochte ich nicht.“
Besser funktioniert es mit dem kostenlosen Begleitdienst, einem ganz neuen Angebot der Stadt München: „Den habe ich schon ausprobiert und war begeistert: Man ruft an, und dann kommt jemand und holt einen zur vereinbarten Zeit zu Hause ab, begleitet z. B. den Weg zum Arzt und kommt eine Stunde später wieder für den Heimweg. Das hat super geklappt.“
Außerdem hat Gudrun Troitzsch eine rechtliche Betreuerin, die sich um die Finanzen, Behördenangelegenheiten usw. kümmert, ihr aber viel Eigenständigkeit lässt und sie nur dort unterstützt, wo es wirklich notwendig ist. Und sie hat bei der Hausnotrufzentrale einen Schlüssel hinterlegt, damit jemand ihr helfen kann, wenn sie in der Wohnung stürzt.
Betroffene und Angehörige in einer Person
In der Betroffenengruppe bei der Alzheimer-Gesellschaft ist Gudrun Troitzsch die einzige, die alleine lebt: „Ich habe oft das Gefühl, ich bin Betroffene und Angehörige in einer Person, weil ich mich ja selbst um mich kümmere. Deshalb ärgert es mich auch, dass die Angehörigen in ihrer Gruppe beispielsweise Infos über die Gesetzesänderungen in der Pflegeversicherung bekommen, wir Betroffenen aber nicht. Das ist für mich doch auch wichtig! Manchmal spreche ich auch mit den Angehörigen der anderen Betroffenen, höre ihre Probleme an und tröste sie.“
Gudrun Troitzsch möchte nicht in einem Heim leben. Dort wäre es zum Beispiel nicht möglich, dass sie wie jetzt nachts um zwei aufsteht, wenn sie sich ausgeschlafen fühlt, und ihren Tag beginnt. Doch sie würde sich für das Leben zu Hause mehr Unterstützung wünschen: „Ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir manchmal zur Seite steht, wie zum Beispiel bei den Arztbesuchen. Aber es müsste jemand sein, der mich tatsächlich nur unterstützt, wo es notwendig ist, und nicht versucht, mir Dinge abzunehmen. Wie die persönlichen Assistenten, die Behinderte unterstützen.
Außerdem würde ich mir Angebote zur Tagesstrukturierung wünschen. Betreuungsgruppen sind nichts für mich. Dort wird gebastelt und gesungen usw., aber ich möchte lieber etwas Sinnvolles tun. Ich gehe regelmäßig zu einer Kochgruppe, wo für 80 Menschen gekocht wird, und helfe den Abwasch zu erledigen. Für psychisch Kranke gibt es Beschäftigungsprojekte, in denen sie in geschütztem Rahmen arbeiten können. So etwas würde ich auch gerne machen.“
Wir brauchen und wollen kein Mitleid
Gudrun Troitzsch ist es wichtig, die Interessen von Menschen mit Demenz zu vertreten und auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen: „Ich gebe gerne Interviews, um den Menschen ohne Demenz zu sagen: Wir brauchen und wollen kein Mitleid. Wir sind noch da, sind aus Fleisch und Blut. Redet mit uns und nehmt uns ernst!“
Das Interview erschien im Alzheimer Info 4/2015. Download Interview
Gespräch mit Gerhard Bräuer, demenzerkrankt, und seiner Lebensgefährtin Birgit Hohnecker
Der Berliner Zahnarzt und Vater von drei Kindern Gerhard Bräuer (59) erhielt 2010 die Diagnose Alzheimer und gab daraufhin seinen Beruf auf. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Birgit Hohnecker berichtete er in der TV-Talkshow von Günther Jauch am 20. November 2011 offen über sein Leben vor und nach der Diagnose. Im Januar 2012 sprachen wir mit beiden in der Geschäftsstelle der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
Herr Bräuer, Sie waren lange Jahre als Zahnarzt tätig.
Gerhard Bräuer: Ja, mehr als 30 Jahre, und es hat mir Spaß gemacht. Nach der Diagnose habe ich einen Rentenantrag gestellt und meine Zulassung zurückgegeben.
Birgit Hohnecker: Und in der Freizeit hat er alle Zahnarztklischees bedient: Porsche fahren, Segeln, Tennis, Skifahren, Golfclub.
Gerhard Bräuer: Ich spiele immer noch Tennis, wenn auch nicht mehr so gut.
Was waren die ersten Anzeichen für eine Demenzerkrankung?
Birgit Hohnecker: Beim Autofahren habe ich einen Rechtsdrall bemerkt. Er hat mal einen Außenspiegel abgefahren und einen Unfall gebaut, ist jemandem draufgefahren. Auch in der Praxis, beim Arbeiten über den Zahnarztspiegel gab es Probleme. Nachdem der Augenarzt bescheinigte hatte, dass mit den Augen alles in Ordnung war, haben wir im Internet die Adresse eines Neurologen rausgesucht und sind da hin. Der hat einige Tests gemacht und da sah es schon sehr nach Alzheimer aus. Aber er hat empfohlen eine ganz gründliche Untersuchung in der Neurologischen Abteilung eines Krankenhauses machen zu lassen. Im März 2010 stand dann die Diagnose Alzheimer fest.
Wie haben Sie auf diese Diagnose reagiert?
Gerhard Bräuer: Erstmal war es ein Schock für mich. Aber ich gewöhne mich eigentlich an alles. Die Traurigkeit hat sich bald wieder gelegt.
Birgit Hohnecker: Wir haben uns gesagt: Wir können uns jetzt vergraben, oder wir machen das Beste daraus. Im Augenblick geht es ja noch ganz gut, da freuen wir uns aneinander.
Gerhard Bräuer: Die Kinder auch. Die Mädchen sind alle zwei Wochen da. Wir haben ein gutes Familienleben.
Birgit Hohnecker: Die Töchter gehen gut damit um, auch seine Geschwister, Freunde und Bekannte. Alle sind nach wie vor da, außer seinem Sohn, der hat den Kontakt abgebrochen. Aber diese Beziehung war schon vorher schwierig.
Gerhard Bräuer: Die gehen alle richtig schön mit mir um.
Birgit Hohnecker: Die Mädchen sagen immer: „Ach Mann, Papa, das hab' ich Dir doch schon erzählt“.
Gerhard Bräuer: Das sagen sie mit einem Augenzwinkern.
Ich habe Glück gehabt, dass die Diagnose schnell klar war. Und jetzt fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Ich weiß, wo ich wohne. Ich kann Einkaufen gehen. Ich muss nicht gepflegt werden.
Sie nehmen an einer Medikamentenstudie der Charité teil. Wie kam es dazu?
Birgit Hohnecker: Eine Bekannte brachte eine Zeitungsanzeige mit, in der Patienten mit Alzheimer für eine Studie gesucht wurden. Die begann 2010 und geht bis März 2012.
Haben Sie das Gefühl, dass das Medikament etwas bringt?
Gerhard Bräuer: Es bringt Hoffnung. Es ist seitdem gleich geblieben.
Birgit Hohnecker: Ja, das zeigt auch das MRT. Verschlechtert hat sich die Aussprache und es gibt Wortfindungsstörungen. Weil es mit dem Sehen etwas schwierig ist, gibt es Schwierigkeiten beim Treppensteigen, besonders abwärts.
Gerhard Bräuer: Ja, das stimmt.
Birgit Hohnecker: Wir lassen es auf uns zukommen. Wie bei einer Schwangerschaft weiß man nicht, was am Ende dabei heraus kommt. Wir machen uns nicht so verrückt. Wir gehen auch nicht in Selbsthilfegruppen oder sprechen mit anderen Betroffenen. Wir lassen es auf uns zukommen. Wenn man mal Hilfe braucht, kann man sich immer noch darum kümmern.
Gerhard Bräuer: Unser Nachbar hatte Alzheimer. Offenbar ein schwerer Verlauf bei ihm.
Birgit Hohnecker: Inzwischen ist er im Heim und erkennt seine Frau nicht mehr. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Wir sind nicht blauäugig. Aber wir versuchen, diese Zeit noch zu genießen.
Haben Sie Vorsorgeverfügungen getroffen?
Birgit Hohnecker: Wir haben die Formulare zu Hause, aber noch nicht ausgefüllt. Ich dachte neulich: Wenn er mal ins Krankenhaus muss, dann bekomme ich keine Auskunft, weil wir nicht verheiratet sind. Wir müssen das bald regeln.
Wie verläuft Ihr Alltag, ohne Berufstätigkeit?
Gerhard Bräuer: Das stört mich nicht. Ich spiele Tennis. Ich gehe morgens, mittags und abends mit dem Hund raus. Das krieg' ich alles noch hin. Ich glaube, es ist eine relativ milde Krankheit, die ich jetzt habe. Das wird natürlich schlimmer.
Birgit Hohnecker: Ich bin seit August wegen eines Rückenproblems krank geschrieben. Jetzt sind wir beide zu Hause, und es ist ganz nett. Wir haben einen festen Tagesrhythmus.
Wie geht es im Tennisverein, seit Ihre Diagnose bekannt ist?
Gerhard Bräuer: Die lassen mich mitspielen (lacht). Ein Tenniskollege, dessen hochaltrige Mutter fortgeschrittenen Alzheimer hat, sagt immer: „Du hast keinen Alzheimer“.
Birgit Hohnecker: Die meisten Leute verbinden Alzheimer gleich mit völlig gaga. Dass es aber einen Weg dort hin gibt, das sehen die nicht.
Gerhard Bräuer: Ja, das sollte besser in die Welt getragen werden. Was ist denn Alzheimer? Leute, die keine Berührungspunkte haben, die wissen das gar nicht.
Birgit Hohnecker: Die Leute sagen: „Ach Gott, Alzheimer, der vergisst alles, der ist nicht mehr lebensfähig, der erkennt keinen mehr“. Das verbinden sie damit. Und wenn sie dann einen sehen, der sich noch einigermaßen ausdrücken kann und noch die Leute erkennt und noch sagt: „Hallo, wie geht’s, wollen wir eine Runde Tennis spielen?“ Dann sagen die: „Du hast keinen Alzheimer“.
Gerhard Bräuer: Manche glauben mir nicht. Irgendwann wird es nicht mehr gehen. Aber wir hoffen, noch ein paar Jahre.
Birgit Hohnecker: Ja, das hoffen wir sehr. Eine Bekannte hat sich viele Jahre um ihren Mann gekümmert, der Alzheimer hat. Sie hat mir erzählt, was sie alles nachts durchgemacht hat. Aber dann wurde es zu viel für sie, und ihr Mann wohnt jetzt in einem Heim. Sie hat mir gesagt, dass er sich da wohl fühlt, dass es ihm da gut geht. Sie ist nach wie vor für ihn da und fährt zu ihm hin. Inzwischen hat sie einen neuen Lebenspartner gefunden, und das finde ich eigentlich ganz toll. Warum sollte sie ihr Leben aufgeben?
Gerhard Bräuer: Das ist eben eine moderne Frau. Die ist zackig und sagt, was sie macht.
Haben Sie mal über das Thema Heim gesprochen? Oder kommt das für Sie gar nicht in Frage?
Gerhard Bräuer: Natürlich kommt das in Frage. Ich möchte niemand zur Last fallen. Es gibt Pflegeeinrichtungen, die das besser können, als die Anverwandten. Ich würde nicht wollen, dass Birgit mich Tag und Nacht pflegt.
Birgit Hohnecker: Das könnte ich auch körperlich gar nicht schaffen.
Gerhard Bräuer: Also, ich geh’ Dir nicht auf’n Wecker.
Birgit Hohnecker: Das ist aber nett von Dir! (lachen)
Gerhard Bräuer: Man muss schon klar sehen, was geht und was nicht. Es kann natürlich sein, dass ich etwas anderes behaupte, wenn ich nicht mehr so klar bin.
Wollen Sie sich vorher ein Heim aussuchen?
Gerhard Bräuer: Ich denke schon mal darüber nach, dass wir mal gucken gehen: Wo geht man hin, wo gefällt es uns, was können wir bezahlen. Aber derzeit haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
Oft hören wir von Angehörigen, die pflegen, bis sie nicht mehr können.
Birgit Hohnecker: Ich glaube, das ist auch falsch verstandene Nächstenliebe. Man muss auch an sich selbst denken. Oft heißt es „Ja, ich hab es Dir versprochen“, aber man denkt letztendlich gar nicht so darüber nach, was das bedeutet.
Wie war die Günther Jauch Sendung für Sie?
Birgit Hohnecker: Wir wurden sehr freundlich behandelt. Da es eigentlich um die Pflegeversicherung ging, fühlten wir uns etwas fehl am Platz. Aber vielleicht als Beispiel für andere: „Versteckt Euch nicht!“
Gerhard Bräuer: Ja, wir sagen immer, dass man sich nicht verstecken sollte. Wir sind halt so, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern was daraus machen.
Herr Bräuer, Frau Hohnecker, wir danken Ihnen für das offene, interessante Gespräch.
Das Interview führten
Susanna Saxl und Hans-Jürgen Freter
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., Berlin
Das Interview erschien im Alzheimer Info 1/2012. Download Interview
„Hier bleib ich meine Person …“ (Frau Carsten)
Im Rahmen des Projekts "Allein lebende Demenzkranke - Schulung in der Kommune" hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft von Juli bis November 2007 Interviews mit Menschen geführt, die mit einer beginnenden Demenz alleine leben. Die Interviews wurden in dem Handbuch "Allein lebende Demenzkranke - Schulung in der Kommune" veröffentlicht.
Zusammenfassung
Die Annahme, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung nicht allein leben können, ist weit verbreitet. Doch was sagen allein lebende Demenzkranke selbst dazu? Wie ist es für sie, mit einer Demenz allein zu leben? Wie kommen sie zurecht und was hilft ihnen dabei? Nehmen sie Grenzen wahr? Welche Ängste, Wünsche und Bedürfnisse haben sie?
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wurden deutschlandweit insgesamt zehn allein lebende Menschen mit Demenz in qualitativen Interviews anhand eines Leitfadens befragt. Fünf verschiedene Porträts zeigen exemplarisch, wie unterschiedlich die Lebenssituation der Betrofenen ist, was sie jeweils bewegt und wie sie das Alleinleben auf ihre ganz persönliche Art und Weise organisieren und gestalten.
Die Interviews haben bestätigt, dass die Diagnose einer Demenzerkrankung und die damit einhergehenden Einschränkungen nicht zu einer veränderten Einstellung gegenüber dem Alleinleben und dem Wunsch nach Selbständig keit in der vertrauten Umgebung führen. Die Demenzerkrankung hat jedoch immer Einluss auf die Lebenssituation und die Selbständigkeit der Alleinlebenden, sowie auf deren Einschätzung ihrer gegenwärtigen Situation. Die Wünsche und Bedürfnisse allein lebender Menschen mit Demenz unterscheiden sich nicht wesentlich von denen gesunder alter Menschen. Sie wollen so lange wie möglich selbstbestimmt und selbständig zuhause im vertrauten Umfeld leben. Allerdings haben die eigenen vier Wände für Demenzkranke eine noch höhere Bedeutung, denn die gewohnte Umgebung vermittelt ihnen nicht nur Geborgenheit und Sicherheit. Durch die vertrauten Räume, Möbel und Bilder und die damit verbundenen Erinnerungen wird auch ihre Identität gestärkt.
Es wurde deutlich, dass die Betrofenen noch viele Fähigkeiten haben, die sie weiter nutzen und erhalten wollen. Sie wollen nicht nur dazugehören und am normalen Leben teilhaben, sondern auch etwas für andere tun können, hilfreich sein. Andernfalls stellt sich für viele die Frage nach dem Sinn, ein Gefühl der Nutzlosigkeit und Resignation wird beschrieben. Außerdem werben die Befragten für mehr Aufklärung und Verständnis für Ihre Erkrankung in der Öfentlichkeit und im unmittelbaren Umfeld. Durch die Erkrankung und das Fortschreiten der Symptome erfahren die Betrofenen immer wieder Grenzen des Lebens allein in den eigenen vier Wänden.
Zwei Faktoren sind zur Beantwortung der Frage, wie lange Menschen mit Demenz allein leben können, von entscheidender Bedeutung: der Verlauf und Schweregrad der Demenzerkrankung sowie das Maß an verfügbarer Unterstützung von außen, auf welche die Alleinlebenden zurückgreifen können und wollen. Ein Zeitpunkt oder ein Ereignis, wann die Grenze des Alleinlebens erreicht sein könnte, wurde von den Betroffenen selbst nicht benannt.
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Interviews ausführlich in drei Abschnitten erläutert: Zunächst folgt eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise und der Zusammensetzung der Interviewpartner. Danach werden fünf ausgewählte Gesprächspartner porträtiert. Im dritten Teil indet sich eine Gesamtauswertung aller zehn Interviews.
Das gesamte Dokument mit allen Interviews finden Sie unter diesem Link
Podcasts
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Episoden unseres Demenz-Podcasts, in denen Menschen mit Demenz von ihren persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Hören Sie zu, wenn sie ihre Geschichten teilen, Einblicke geben und wertvolle Tipps für den Alltag bieten. Diese Folgen bieten eine wichtige Perspektive für alle, die sich mit dem Thema Demenz auseinandersetzen.
- Folge 8: Sexualität und Demenz
- Folge 28: Jungerkrankte – Demenz in jungen Lebensjahren
- Folge 29: Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz
- Folge 45: Demenz und Nähe
- Folge 46: Alleinleben mit Demenz
- Folge 53: Demenz und Humor
- Folge 54: Die Welt steht Kopf
- Folge 61: Beziehungsarbeit
- Folge 66: Beirat "Leben mit Demenz"
Literaturhinweise
Davide: Miss Demenzia und ihr demenzielles Herrchen. Ein Früh-Demenz-Betroffener berichtet
Erschienen im Eigenverlag, Berlin 2021
Davide nennt sein Buch einen "Ratgebenden Erfahrungsbericht". Genau das will er: Anderen Demenz-Betroffenen von seinen Erfahrungen berichten und ihnen Mut machen, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Davide erzählt in kurzen Abschnitten, was ihm selbst im Alltag mit der Demenz begegnet, und er lässt auch andere betroffene zu Wort kommen. Er sagt: "Der Demenz können wir positiv begegnen. Sie kann eine große Chance sein. Ein Geschenk. Aber nur wenn wir das Geschenkpaket auch öffnen, können wir etwas Gutes damit beginnen. Tun wir es nicht, kann die Demenz zu einer traurigen, fiesen Angelegenheit werden."
Davide ist selbst noch berufstätig in der Pflege, wenn auch in einem reduzierten Stundenumfang. Dadurch kennt er das Leben mit Demenz quasi aus zwei Perspektiven und äußert auch seine berechtigte Kritik an der Betreuung die Menschen mit Demenz oftmals in Pflegeheimen aber auch zu Hause erhalten.
Das ist ein sehr authentisches, ein sehr wichtiges Buch.
Es kostet 16 Euro + Versand und ist nur direkt bei Davide per E-Mail an kotti36[at]web.de zu bestellen.
Sehr lesenswert ist außerdem Davides Blog auf Facebook "Demenz - Leben zwischen Glanz & Blues"
Susanna Saxl, Berlin
Peter Wißmann, Leo Beni Steinauer, Rolf Könemann: Herausforderung angenommen! Unser neues Leben mit Demenz
Erschienen im Hogrefe Verlag 2021

Ein Fachbuch im gewöhnlichen Sinn sollte dieses Buch über das Paar Beni und Rolf nicht werden. Vielmehr soll es eine sehr breite Leserschaft ansprechen: Menschen, die selbst eine Demenzdiagnose erhalten haben, ihre An- und Zugehörigen sowie Interessierte, die Menschen mit Demenz im Alltag, beispielsweise im Supermarkt, im Bus oder beim Arztbesuch begegnen können. Ganz persönliche Einblicke in das sich verändernde Leben der beiden Herren zu ermöglichen und offen mit einer Demenzdiagnose umzugehen, sei das Ziel, denn bei dem Anfang sechzigjährigen Beni wird (zunächst) eine Lewy-Body-Demenz festgestellt. „Wir wollen anderen Mut machen, ihr Leben mit einer Demenz anzunehmen und das Beste daraus zu machen,“ so Beni Steinauer. Das Buch ist in Kapitel nach Themen unterteilt, die für beide spätestens seit der Diagnose wichtig sind (zum Beispiel „Wie sich das Leben verändert“, „Erfolge und Niederlagen im Alltag“, „Wie sich die Beziehung verändert“, „Familie und Freunde als Stütze“). Neben persönlichen Anekdoten und Fotos runden weiterführende Informationen („Gut zu wissen!“) und Interviews die Kapitel ab. Das Buch lässt sich von vorne bis hinten aber auch individuell kapitelweise lesen. Am Ende kann man sagen, dass man durch diese kurzweilige Lektüre das Paar ein wenig kennenlernen durfte und hofft, dass sie noch viele Jahre so mutig und (selbst)bewusst ihr gemeinsames Leben nach dem Motto „Herausforderung angenommen!“ leben können.
Jessica Kortyla, Berlin
Wendy Mitchell: Der Mensch, der ich einst war
Erschienen im Rowohlt Verlag 2019
Die Diagnose "Alzheimer" war für die 58-jährige Wendy Mitchell zunächst ein Schock. Doch sie beschließt, nicht aufzugeben und entwickelt viele Strategien zum Umgang mit den Schwierigkeiten, die ihr begegnen: „Eine Situation, die sich auf den ersten Blick als Schlusspunkt oder als Anfang vom Ende darstellt, verwandelt sich in ein Komma.“ Sie wird zur Demenz-Botschafterin, um möglichst vielen Menschen zu zeigen, dass sie ihr Bild von Menschen mit Demenz überdenken sollten.
In dem Buch beschreibt sie die Entwicklung ihrer Geschichte mit der Demenz chronologisch. In einer Art Briefe an ihr altes Ich ohne Demenz vergleicht sie immer wieder die Wendy von heute mit der von früher. Dabei wird deutlich, wie sehr die Demenz sie verändert hat, aber auch dass es durchaus positive Aspekte dabei gibt. Ein Buch, das Mut macht!
Wendy Mitchell hat außerdem in einem Online-Blog über Leben mit der Demenz geschrieben. Sie ist im Februar 2024 verstorben.
Hier geht's zu Wendy's Blog.
Susanna Saxl-Reisen, Berlin
Richard Taylor: „Hallo Mister Alzheimer“ Wie kann man weiterleben mit Demenz? – Einsichten eines Betroffenen
Huber Verlag 2013
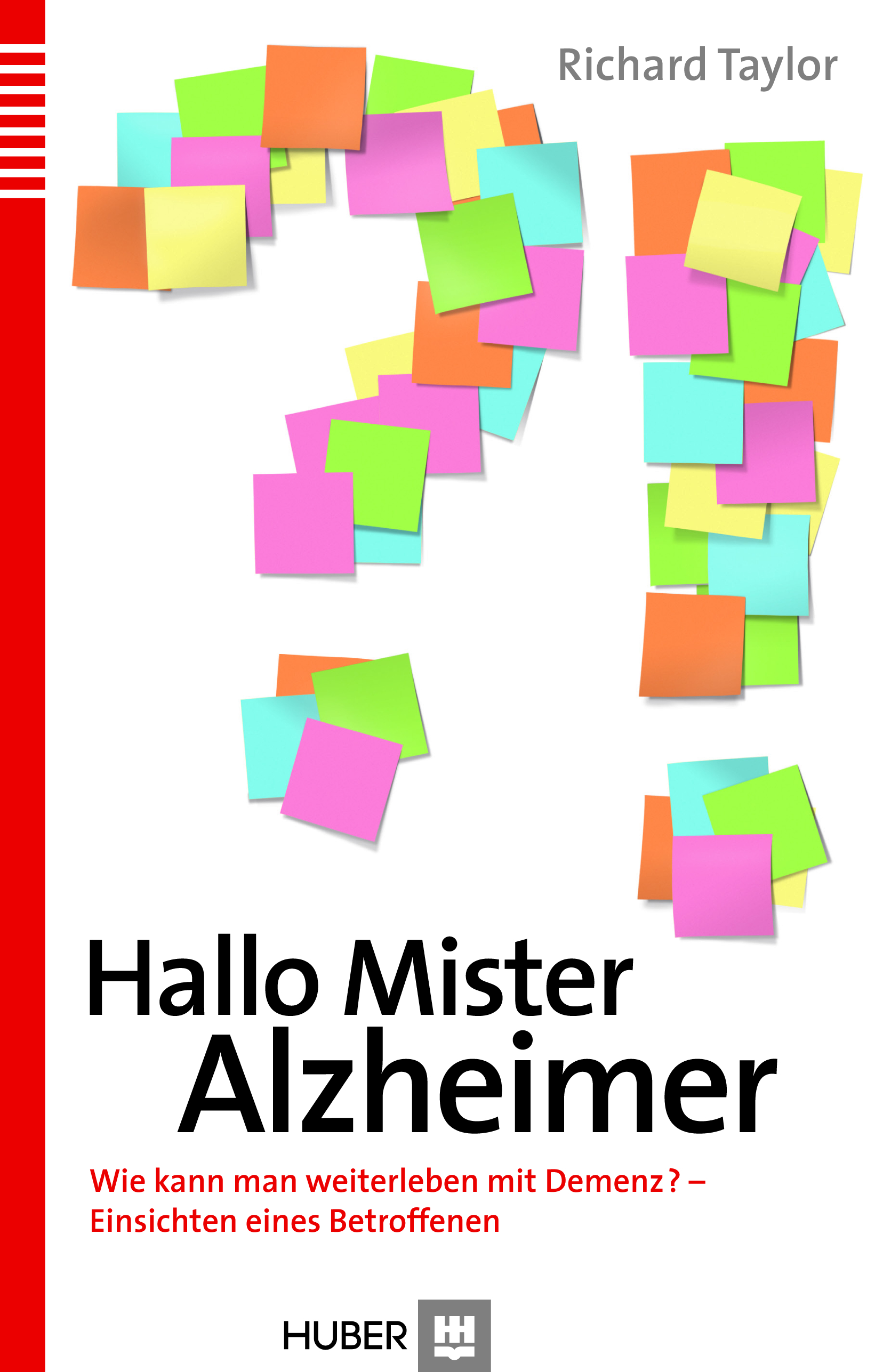
Nachdem Richard Taylor sein erstes Buch „Alzheimer und Ich“ veröffentlicht hatte, erhielt er viele Leserbriefe. Menschen mit Demenz sowie Angehörige wendeten sich mit Fragen an ihn. Einige dieser Fragen sowie die Antworten Richard Taylors sind im vorliegenden Buch „Hallo Mister Alzheimer“ zusammengefasst.
Taylor beantwortet die Fragen aus seiner Sicht als Demenzbetroffener. Er nimmt Bezug auf seine Erfahrungen und scheut sich nicht einzugestehen, dass er aus heutiger Sicht einiges anders gemacht hätte. So würde er heute z. B. eher mit seiner Familie und seinem Arbeitgeber über die Diagnose und deren Folgen sprechen.
Das große Spektrum der Fragen reicht von „Wie bekomme ich meinen Mann zum Duschen?“ bis hin zu „Was habe ich falsch gemacht?“. Ganz praktische, alltägliche Aspekte werden also ebenso angesprochen, wie eher philosophisches Fragen.
Richard Taylor verfügt über viele Informationen und Erfahrungen aus erster Hand. Er hat vielfältige Kontakte – besonders zu anderen Menschen mit Demenz. Seine Antworten sind trotz allem sehr persönlich. Nicht jeder Mensch mit Demenz wird Dinge genauso sehen oder empfinden wie er. Nicht alle Antworten werden also für jeden einzelnen Leser und seine persönliche Situation als Erkrankter oder Angehöriger passend sein. Aber vielleicht regen sie dazu an, über einige Fragen anders nachzudenken und neue Wege auszuprobieren.
Für all jene, die das Buch aus beruflichen Gründen lesen, sind insbesondere die Antworten interessant, um sich besser in die Situation eines Menschen mit Demenz hinein versetzen zu können und um zu lernen, von Anfang an und immer wieder die Perspektive der Erkrankten mitzudenken, ihre Wünsche und Forderungen zu erfragen und zu beachten.
Saskia Weiß, Berlin
Christine Bryden: Mein Tanz mit der Demenz. Trotzdem positiv leben
Huber Verlag 2011
Mit Demenz positiv leben - Geht das überhaupt? Christine Bryden macht uns mit ihrem Buch deutlich, dass die Diagnose Demenz nicht das Ende des Lebens ist, sondern dass man auch mit einer Demenzerkrankung noch gern leben, positive Erlebnisse haben und neue, schöne Erfahrungen machen kann.
Während sie sich in ihrem ersten Buch „Who will I be when I die“ noch mit der Angst vor dem Verlust ihrer Identität auseinandersetzt, nimmt sie uns in dem zweiten Buch „Mein Tanz mit der Demenz“ mit auf eine Reise, die voll ist von Erlebnissen, die Mut machen. Sie hat das Glück, schon erkrankt, einen neuen Partner zu finden und zu heiraten. Das ist sicher nicht alltäglich. Aber sie zeigt uns auch, wie ihre Offenheit, ihre Art und Weise mit der Krankheit umzugehen ihr viel Unterstützung und Zuspruch von ganz unterschiedlichen Menschen gibt. Ein positives Beispiel für andere von dieser Diagnose betroffene Menschen, aber auch für uns Ansprechpartner.
Sabine Jansen, Berlin
Weitere Literaturhinweise
- Christian Zimmermann, Peter Wißmann: Auf dem Weg mit Alzheimer. Wie sich mit einer Demenz leben lässt
Mabuse Verlag 2011 (2012 auch als Hörbuch erschienen) - Gudrun Piechotta (Hrsg.): Das Vergessen erleben. Lebensgeschichten von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung
Mabuse-Verlag 2008 - Richard Taylor: Alzheimer und ich. „Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf“
Hogrefe, 4. Auflage 2025
Weitere Vorträge und Interviews
- Doris Wohlrab, Christine Zarzitzky, Christian Zimmermann: Demenz mitten im Leben. Ein psychoedukatives Angebot für jüngere Menschen mit Demenz im frühen Stadium und deren Angehörige.
Erschienen im Kongressband „Aktiv für Demenzkranke“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft , Berlin, 2009 - Gruppe „Demenz mitten im Leben“, München: Demenz mitten im Leben - Was bedeutet das? (aus Alzheimer Info 1/2008)
- Interview mit einem Alzheimer-Erkrankten: Dran bleiben – nicht zurückziehen! (Aus Alzheimer Info 1/2008)
- Gespräch mit Lynn Jackson, die mit einer Frontotemporalen Demenz lebt: Eine Diagnose ist wichtig (aus Alzheimer Info 2/2005)